Newsletter
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Aktionen, Neuigkeiten zu Produkten und pflanzenbaulichen Empfehlungen. Die Abmeldung ist jederzeit möglich.
Auf fast der Hälfte der deutschen Getreidefläche wird Winterweizen angebaut. Diese Kultur ist damit eine der größten Ackerfrüchte und für viele Betriebe auch wirtschaftlich von großer Bedeutung. Ein Großteil des geernteten Weizens soll später zur Erzeugung hochwertiger Lebensmittel verwendet werden. Dazu müssen jedoch einige Anforderungen an die Qualitätsparameter für Weizen, beispielsweise ein ausreichend hoher Rohproteingehalt, erfüllt werden.
Im Schnitt der letzten Jahre haben die Rohproteingehalte in den angelieferten Weizenpartien, ergänzt um wenige Ausnahmen, jedoch permanent abgenommen. Auch für den Export ist der Eiweißgehalt ein wertbestimmender Faktor. Weizen mit zu niedrigem Rohproteingehalt kann oft nur als Futterweizen, mit entsprechenden Preisabschlägen, vermarktet werden. Aber nicht nur für den Export ist der Eiweißgehalt ein wertbestimmender Faktor, auch viele weitere Abnehmer setzen auf entsprechend hohe Proteingehalte im Backgetreide.
Insbesondere im Hinblick auf die N-Düngerestriktionen, welche durch die Novellierung der Düngeverordnung (DüV) festgelegt wurden, ist die Erzeugung von Qualitätsweizen zunehmend schwieriger geworden.
Die Ursachen für den Rückgang des Rohproteingehaltes sind vielschichtig und können meist nicht alleinig an einer reglementierten Stickstoffdüngung festgemacht werden.
Der erste Schritt beim erfolgreichen Weizenanbau stellt die Definition des Anbauziels dar, welches sich aus der angestrebten Verwendung der zukünftigen Ernte ergibt. Wird der Weizen über den Landhandel möglicherweise in den Export vermarktet, ist und bleibt der Rohproteingehalt das wertbestimmende Kriterium. Wer mindestens B-Weizen-Qualität vermarkten möchte, sollte auch auf eine proteinstarke B-Weizensorte oder sicherer auf A-Weizengenetik setzen, um dieses Ziel zu erreichen.
Mit der Auswahl der richtigen Sorte und einer optimalen Aussaat wird der Grundstein für den späteren Erfolg gelegt.
Ist das Stickstoffangebot limitiert, gilt es die Grundnährstoffe wie Phosphat, Kalium, Magnesium, Calcium und Schwefel ins Optimum zu bringen. Bis auf Schwefel sind die Nährstoffe im Boden mehr oder weniger mobil und meist an Austauscher gebunden. Schwefel verhält sich hingegen ähnlich wie Nitrat und ist in der Bodenlösung sehr mobil und dadurch leicht auswaschbar.
Je schwerer der Boden, desto besser ist in der Regel die Austauschkapazität, je leichter der Boden, desto stärker ist die mögliche Verlagerung der Nährstoffe durch Auswaschung aus dem Wurzelraum. Daher ist eine Ausgleichsdüngung der genannten Nährstoffe vor allem auf leichten Böden spätestens alle drei Jahre unumgänglich. Wird das Stroh abgefahren und erfolgt keine Rückführung in Form von organischen Düngern, so muss dies ebenfalls bei der mineralischen Grunddüngung beachtet werden. Denn auch Phosphor und Kalium haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Qualität der späteren Ernte.
Für eine erfolgreiche Überwinterung der Saat ist neben einer ausreichenden Versorgung mit Makronährstoffen wie Kalium und Magnesium, auch die Spurenelementversorgung mit Nährstoffen wie Kupfer, Mangan und Zink elementar. Insbesondere auf Flächen, die in der Vergangenheit nicht oder nur geringfügig mit organischen Düngern versorgt wurden, tritt häufig ein Mangel dieser Nährstoffe auf, aber auch auf Flächen, die häufig mit Gülle oder Mist gedüngt werden kann ein Mangel in der Kulturpflanze in Erscheinung treten. Staunässe, schwierige Aussaatbedingungen oder Nährstoffantagonismen sind mögliche Gründe dafür. Genau hier schafft eine Blattdüngung von Mikronährstoffen Abhilfe.
Ab dem Frühjahr gilt es mit der richtigen N-Düngestrategie und Bestandesführung, die im Herbst gelegte Grundlage erfolgreich zur Ernte zu bringen.
Für eine effiziente Stickstoffaufnahme und Verwertung in der Pflanze muss ab Vegetationsbeginn ausreichend pflanzenverfügbarer Schwefel in Form von Sulfat vorhanden sein. Dieser wird mit der ersten Stickstoffgabe gedüngt, da zu Vegetationsbeginn die Mineralisierung von Stickstoff und Schwefel aus den Bodenvorräten nur sehr langsam vonstattengeht. Hierzu bieten sich schnell verfügbare Stickstoff-Formen wie Nitrat und Ammonium in Kombination mit Sulfatschwefel an.
In Regionen, die mit regelmäßigen und gleichmäßig verteilten Niederschlägen rechnen können, kann die Stickstoffmenge nach der klassischen Gabenteilung, Bestockungsgabe, Schossergabe und Qualitätsgabe, aufgeteilt werden.
In Regionen mit ausgeprägter Frühsommertrockenheit sollte bereits vor Beginn der Trockenperiode rund 80 % des N-Bedarfs gedüngt und durch ausreichende Niederschläge in den Boden eingewaschen sein. Um hier unnötige Stickstoffverluste zu vermeiden, ist die stabilisierte Stickstoffdüngung zumindest ab der zweiten Gabe zu bevorzugen. Dabei wird auf Dünger mit Nitrifikationshemmer und Ureaseinhibitoren gesetzt.
Für beide Düngevarianten bietet es sich an, rund 10 bis 20 kg/ha Stickstoff für eine Blattdüngung ab dem Ährenschieben zurückzuhalten. Durch solch eine Maßnahme kann nochmals Einfluss auf den späteren Rohproteingehalt im Korn genommen werden.
Für die Erzeugung von Qualitätsweizen ist eine betriebsindividuelle und ganzheitliche Strategie unter Einbezug von Sortenwahl, Nährstoffversorgung, Pflanzenschutz und Fruchtfolge notwendig.


Christian Gölz
Fachberatung Pflanzenbau
Tel.: +49 731 9342 625
Mobil: +49 175 6539780
Mail: [email protected]
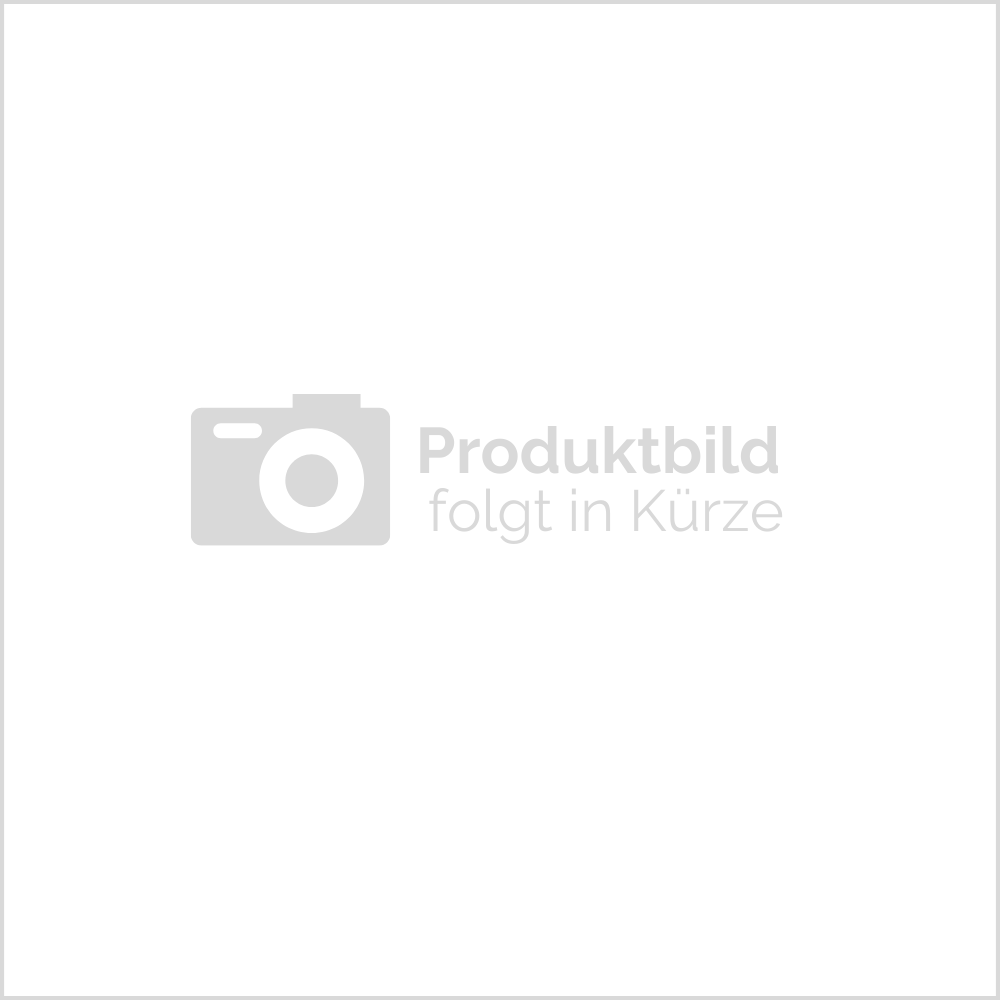
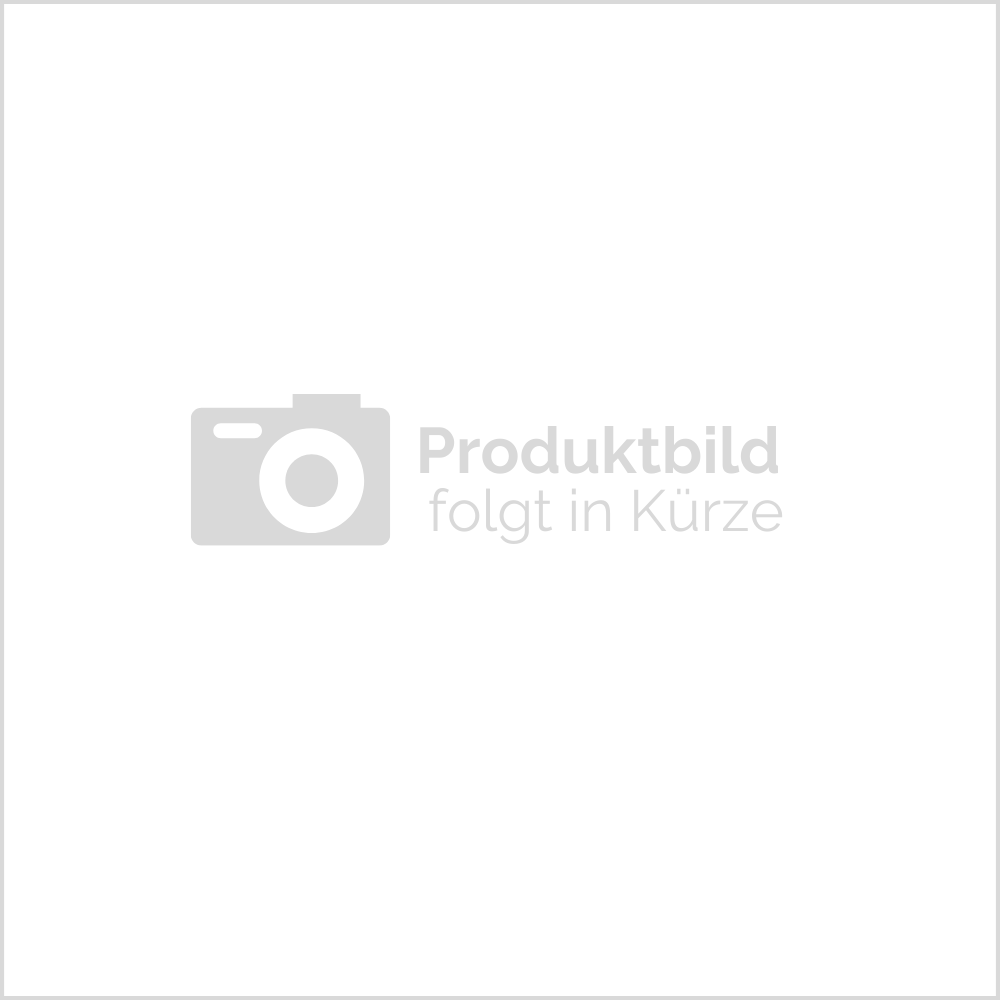
Helmut Pförtner
Produktmanagement Rind
Tel.: +49 4841 8988 474
Mobil: +49 163 2870 086
Mail: [email protected]